Magazin
Wählen Sie Ihr Thema:
Wählen Sie Ihr Thema:
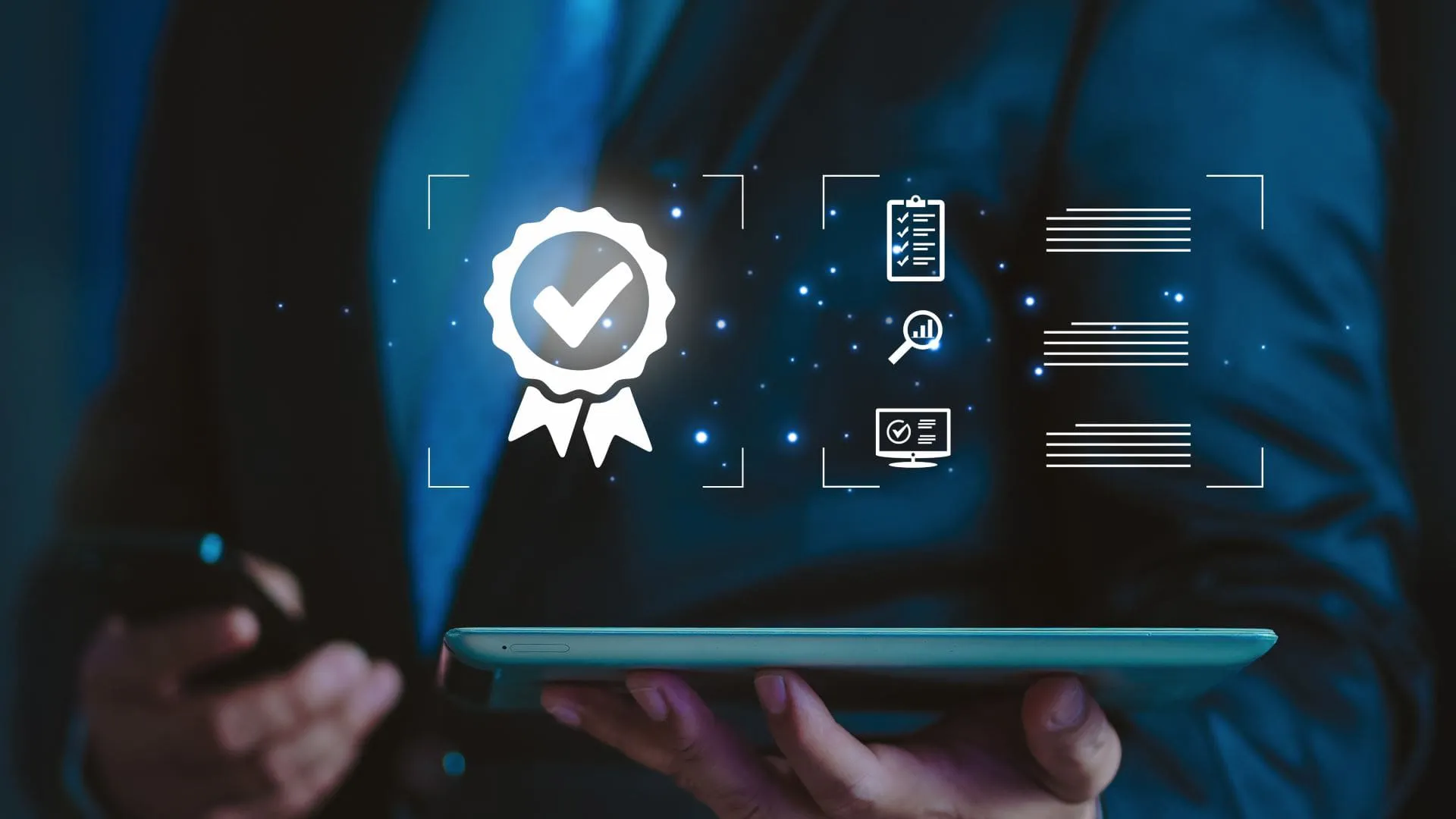
Die Anforderungen an Cybersicherheit steigen – doch welche Vorgaben gelten für Ihr Unternehmen und welche Standards lohnen sich freiwillig? Der Artikel bietet eine kompakte Entscheidungshilfe, um zwischen NIS-2, DORA, ISO/IEC 27001 und TISAX gezielt die passende Sicherheitsstrategie auszuwählen.
Artikel lesen
Ein IT-Notfallplan sorgt für schnelle, koordinierte Reaktionen bei Cyberangriffen oder Ausfällen und schützt so den Geschäftsbetrieb. Sehen Sie, wie Sie in fünf Schritten die Cyberresilienz stärken können.
Artikel lesen
Mit ADA beginnt ein Paradigmenwechsel in der Applikationsentwicklung: Statt punktueller Codehilfe bietet der KI-Agent eine ganzheitliche, standardkonforme Prozessunterstützung über den gesamten Systementwicklungszyklus.
Artikel lesen
Cyberresilienz ist für Unternehmen essenziell, um sich gegen die zunehmenden Bedrohungen in der digitalen Welt zu schützen. Was sind die häufigsten Schwachstellen, die ein Cybersecurity Assessment aufdeckt und welche Lösungen gibt es?
Artikel lesen
Low-Code-Plattformen haben sich als Schlüsseltechnologie für die schnelle und effiziente Anwendungsentwicklung etabliert, indem sie die Abhängigkeit von spezialisierten Programmierkenntnissen verringern. Oracle APEX ist dabei besonders gut positioniert, um von der Integration von KI, Automatisierung und Cloud-Strategien zu profitieren.
Artikel lesen